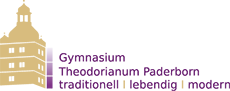DKDTS an unserer Schule – Das Projekt gegen das Vergessen
Im vergangenen Schuljahr, vom Sommer 2024 bis in den Frühling 2025, haben sich mehr als 100 Schüler:innen unserer Schule zusammen mit vielen Lehrkräften aus den verschiedensten Bereichen an dem Schulprojekt rund um das Musikdrama "Die Kinder der toten Stadt" beteiligt. Es stellte oft eine Herausforderung dar, doch dank der großartigen Zusammenarbeit unter allen Mitwirkenden konnten wir diese am Ende bewältigen und nach Monaten intensiver Vorbereitungen ein sowohl emotional aufgeladenes als auch politisch-historisch relevantes Stück auf die Bühne bringen und das umsetzen, was der Untertitel verspricht: Gegen das Vergessen wirken.
Das Musikdrama "Die Kinder der toten Stadt" leistet aktive Gedenkarbeit, indem es die Aufmerksamkeit der Zuschauenden für einen Abend auf das schreckliche Schicksal der Kinder lenkt, die während des zweiten Weltkriegs im Ghetto Theresienstadt gefangen gehalten und gezwungenermaßen Teil der nationalsozialistischen Propaganda wurden, als sie eine Kinderoper aufführen sollten. Sicherlich berührt es viele auch über den Abend hinaus. Darüberhinaus hat es aber die wahrscheinlich größte Erinnerungsarbeit im Rahmen des Projekts selbst geleistet. Denn wir, die wir uns knapp ein Jahr lang intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, und die Menschen, die uns nahestehen und währenddessen begleitet haben, werden nicht so schnell vergessen – im Guten, wie im Schlechten.
Um es nämlich zur Aufführung zu bringen, waren Zeit, Fleiß und Vorstellungskraft nötig. Letztendlich haben sich die Gedanken vieler ständig um dieses Projekt gedreht – und um alles, was damit in Zusammenhang steht. Dessen Kern zu erfassen ist zwar nicht einfach, am Ende des Prologs wird aber folgende Aussage über den Inhalt getroffen, die bei der Einordnung helfen kann:
"Dies ist nicht die Geschichte von Kindern in Not – Auch wenn sie allein davon handelt." Es bleibt "nur" noch die Frage zurück, was genau denn eigentlich der Unterschied zwischen "Sein" und "Handeln" ist.
Das Besondere des Musikdramas ist, dass die Kinder im Mittelpunkt der Handlung stehen. Sie besitzen eine wichtige Rolle – damals als Hoffnungstragende und heute als Übermittelnde. In Theresienstadt haben wir das damalige Kinderheim gesehen, für das sich die Inhaftierten, in der Hoffnung, dass zumindest einige Kinder das Ghetto überleben könnten, eingesetzt haben.
Und heute? Sie sind die letzten Überlebenden, mittlerweile die wenigen Einzigen, die noch von ihren Erlebnissen erzählen können und damit gegen das Vergessen kämpfen. Aber das Musikdrama hat uns etwas Entscheidendes gezeigt: Wir können wider das Vergessen kämpfen, auch wenn wir keine Zeitzeugen sind. Denn die Kinder der toten Stadt haben uns zu Zweitzeugen gemacht. Genauer gesagt Michaela Vidlakova, auf deren wahrer Geschichte die Figur Benjamin basiert. Sie hat uns während unserer Exkursion nach Theresienstadt von ihrem Leben und ihren Erfahrungen als Kind im Ghetto erzählt. Für uns ein gutes und wichtiges Erlebnis, aber auch eine Möglichkeit, die es mit der Zeit nicht mehr geben wird. Das macht die Erinnerungskultur in den nachfolgenden Generationen, und damit auch das Musikdrama "Die Kinder der toten Stadt", umso kostbarer – und notwendiger.
Zu Beginn war es zwar ein Streitpunkt, ob wir aus unserer privilegierten Welt heraus ein Stück, das in einer ganz anderen Realität spielt, auf die Bühne bringen können. Auch die Richtigkeit des Ansatzes, diese Vergangenheit nachbilden zu wollen und in Form eines Theaterspiels aufzuführen, wurde diskutiert. Ich weiß jetzt von der Schwierigkeit und Gefahr, die dies mit sich bringt. Dennoch bin ich überzeugt, dass es gelungen ist. Denn ich denke, ich spreche für fast alle, wenn ich sage, dass DKDTS uns die Thematik insgesamt deutlich nähergebracht hat, als der Geschichts- oder Religionsunterricht es je könnte und dass gewisse Lehraufträge direkt im Rahmen eines freiwilligen Schulprojekts erfüllt wurden. Kann es unter diesem Blickpunkt überhaupt noch verwerflich sein? Die Intention, zu erinnern, wurde über allen Maßen erfüllt. Die schlichte, unreflektierte Abbildung der Vergangenheit währenddessen war nie die eigentliche Idee von "Die Kinder der toten Stadt". Sie mag nötig sein, um die Botschaft zu vermitteln und Emotionen hervorzurufen. Auf der anderen Seite muss das Bewusstsein dafür da sein, dass diese Emotionen den Gefühlen, die in Theresienstadt geherrscht haben, nicht gleichkommen und auch die Kinder auf der Bühne nicht in der Situation der deportierten Kinder sind.
Außerdem ist "Handeln" nur die eine Seite von "Sein" und "Handeln". Die Handlung kann sich also auf die Kinder konzentrieren, die Geschichte aber gleichzeitig noch mehr "sein":
Für mich zum Beispiel ist sie:
Eine Geschichte über die Hoffnung und Unbeschwertheit in schwerstem Leid, über Liebe und Trauer, die viel zu eng verbunden sind, weil der Tod niemals müde wird.
Eine Geschichte über die Sehnsucht nach Freiheit, nach Freiraum und einem Rückzugsort, den Theresienstadt nicht ermöglicht, aber genauso nach einem Ende der Unterdrückung und Entmenschlichung durch grausame Menschen – und gleichzeitig Zweifel daran, dass es je wieder sein kann wie zuvor.
Und unter diesen Umständen auch eine Geschichte, die die Kraft von Musik ausdrückt.
Für uns aber, die wir diese Grausamkeiten nicht erlebt haben und das Leid der Inhaftierten niemals auch nur ansatzweise nachvollziehen könnten, ist es
Ein Musikdrama gegen das Vergessen.
Damit wir uns daran erinnern, was die Geschichte ist.
Das Stück "Die Kinder der toten Stadt" erfüllt die Intention der aktiven Gedenkarbeit überaus, wie ich finde. Diese wirklich starke Leistung macht ein solches Musikdrama, gerade im schulischen Zusammenhang, unglaublich mächtig.
Tatsächlich ist es in der Form des Musikdramas auch ziemlich einzigartig mit seiner großen Reichweite, aber gleichzeitig besonders wirkungsvoll. Dazu tragen auch die verschiedenen, tief berührenden Handlungsstränge bei, die auf den ganz individuellen Einzelschicksalen der damals inhaftierten Kinder beruhen. Ihre bunten Geschichten sind wunderschön und, vor dem Hintergrund, dass kaum jemand von ihnen überleben konnte, tragisch zugleich. Auch oder vor allem aus diesem Grund ist das Stück "Die Kinder der toten Stadt" vor einigen Jahren entstanden – um die Geschichten derer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, die sie nicht oder nicht mehr selbst erzählen können. Ich habe gelernt, dass wir die Verantwortung für die Erinnerung tragen. Wir sind es den Kindern aus Theresienstadt – und so vielen mehr – schuldig.
Glücklicherweise gibt es Menschen wie Frau Dr. Sarah Kass, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Geschichten der Kinder zusammenzutragen und ein Musikdrama darum herum aufzubauen. Genauso wichtig für das Projekt waren aber wohl auch Lars Hesse, der Komponist, und Thomas Auerswald, der die Texte verfasst hat. Dank dieses Trios konnte "Die Kinder der toten Stadt" 2018 uraufgeführt werden. Vorstellungen im schulischen Rahmen finden seit einigen Jahren ebenfalls statt, sodass im vergangenen Jahr auch unsere Schule, das THEO, diese Herausforderung und gleichzeitig das Geschenk, das DKDTS – wie das Schulprojekt bald nur noch genannt wurde – darstellt, angenommen hat.
Von da an haben uns "Die Kinder der toten Stadt" beinahe ein Jahr lang, vom ersten Treffen im Juni 2024 bis zur letzten Aufführung im April 2025, begleitet. Ich erinnere mich noch an den Moment, in dem Frau Brill mir und anderen aus dem Orchester auf der Musikfahrt 2024 von dem Musikdrama erzählt hat. Sie konnte uns von Anfang an für dieses Projekt begeistern. Ich war sehr beeindruckt von der Idee und hatte mir tatsächlich auch schon länger eine größere Zusammenarbeit zwischen Chor und Orchester gewünscht. Auch wenn es größenwahnsinnig schien, die Musik mit einem schuleigenen Orchester spielen und eine kaum gekürzte Fassung inszenieren zu wollen – in welcher Größenordnung das Ganze wirklich lag und wieviele weitere Arbeitsgruppen beteiligt sein würden, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen. Auch noch, als die Planungen schließlich konkreter wurden und bereits vor den Sommerferien das erste Treffen mit allen in der Aula stattfand, schienen die Aufführungen in weiter Ferne. Dementsprechend musste sich auch das Bewusstsein für die Knappheit der Zeit erst einstellen. Spätestens ab dem zweiten Quartal des neuen Schuljahres nahmen die Proben aber richtig an Fahrt auf und die ersten Probenwochenenden intensivierten die Erfahrung zusätzlich. Akt für Akt haben wir uns "Die Kinder der toten Stadt" erarbeitet, oft auch unter der Anleitung von älteren Schüler:innen, die Frau Röder bei den Proben des Gesang-Schauspiel-Teams tatkräftig unterstützt haben. Adelheit, Lina, Tabea, Matti und Sebastian waren zwar selbst als Solistinnen und Solisten sowie teils auch noch zusätzlich im Orchester stark involviert, das hat sie aber nicht davon abgehalten, Regie zu führen und die Proben mitzugestalten. Ich habe wirklich großen Respekt vor dem, was diese fünf im vergangenen Jahr geleistet haben und möchte ihnen und Frau Röder an dieser Stelle noch einmal im Namen des Schauspiel & Gesang-Teams Danke sagen. Ohne sie wäre vieles nicht möglich gewesen.
Vom Einsatz Einzelner abgesehen fand ich schlussendlich jedoch besonders beeindruckend, wie viel wir in der Gruppe, alle zusammen, geschafft haben. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, das das Schulprojekt uns gezeigt hat. Die Erfahrung hat uns Zusammenhalt gegeben und die Schulgemeinschaft um ein Vielfaches gestärkt. Unser Hausmeister Herr Gloede, der während der Proben ebenfalls von großer Bedeutung war und es darüberhinaus täglich in unserem Schulalltag ist, aber auch stets einen guten Überblick hat, kann diese Beobachtung bestätigen. Er hat mir erzählt, dass Kinder, die in die 6. Klasse gehen, Schülerinnen aus der Q2 nach deren Abitur vermissen würden. DKDTS hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben, uns jahrgangsübergreifend besser kennenzulernen, wodurch nicht selten neue Freundschaften entstanden sind. Diese wiederum haben auch aus teils anstrengenden Proben tolle Erlebnisse gemacht. Zumindest wenn ich jetzt an die Zeit an sich zurückdenke und wieder hinter den Häusern sitze, um mich herum Hände, die während „Liebe kann alles“ Herzen zeigen und sich so gegenseitig für zwei bis drei weitere Akte anfeuern, wenn ich mir bewusst mache, wieviele Menschen sich, vor wie hinter den Kulissen, an diesem einzigartigen Schulprojekt beteiligt haben, wird mir bewusst, was ich auch für schöne Erfahrungen im Zusammenhang mit DKDTS machen durfte. Diese gehen manchmal unter, sind aber auch sehr berechtigt, wie ich finde. Wir hatten alle ein gemeinsames Ziel vor Augen und konnten es durch viele kleine und größere Beiträge zum Endprodukt erreichen. Diese Erinnerung tut immer wieder gut, es ist ein tolles Gefühl, in der Schule so eine starke Gemeinschaft um mich herum zu wissen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass wir sehr viel reicher aus dem Schulprojekt herausgegangen sind. Wir haben viel Neues gelernt, sei es in der Geschichts-AG, auf der Exkursion nach Theresienstadt oder einfach im Gespräch. Dieses neue Wissen, aber auch die Ohrwürmer, unsere Mitschüler:innen, mit denen wir diese wertvollen Erinnerungen teilen, und der Baum wider das Vergessen halten unsere Erinnerung wach. Damit schließt sich der Kreis.
„Die Kinder der toten Stadt“ – das Musikdrama gegen das Vergessen – erfüllt, wofür es steht, und das Schulprojekt DKDTS hat uns außerdem eine Schulgemeinschaft geschenkt, auf die wir stolz sein, und in der wir uns wohl fühlen können. Ein voller Erfolg!
Julika Stadler, 10a